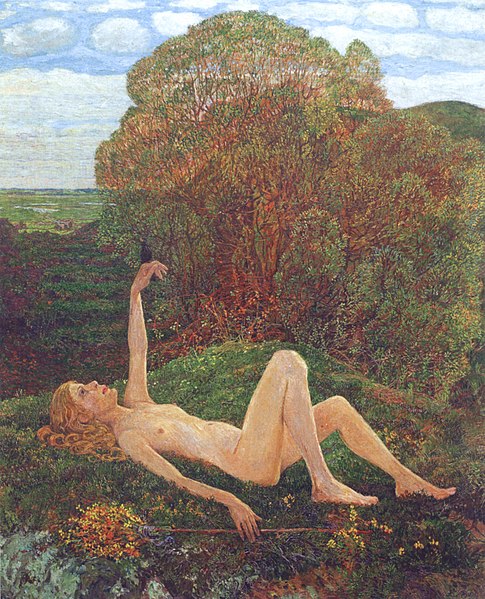Alle Personen sind unfrei erfunden. Sie sehen vielleicht ein bisschen aus, wie irgendwer, aber ihr Inneres ist ganz anders. Ich habe auch keinen Einfluss auf sie. Beschwerden sind sinnlos. Die Figuren machen, was sie wollen.
Als Charlotte aufwachte, tobte der Sturm immer noch. So wie am Tag zuvor. So wie seit drei Tagen und drei Nächten. Sie hatte behaglich von Johnny Depp geträumt, dem eine junge Ausgabe ihrer selbst auf einer Party begegnet war. Im Traum war er an ihr interessiert gewesen und wollte mit ihr woanders hingehen, aber den Ausgang finden war so schwer gewesen. Dann, wie gesagt, als sie aufwachte, tobte immer noch der Sturm. Und sie überlegte, ob sie ihrem Hund ein Badetuch als Sturmjacke anziehen solle, oder ob sie vielleicht selbst eine Sturmjacke brauche. Und plötzlich hörte der Wind abrupt auf. Stille.
Es musste etwas passiert sein. Charlotte stand eilig auf, zog sich an, warf sich Wasser ins Gesicht und eilte ins Dorf. Am Dorfbrunnen, gegenüber dem Kriegerdenkmal hatte der Mob (?) Pierre an der Nymphenskulptur befestigt. Die Arme ausgestreckt, sah er aus wie Winnetou (auch ein Pierre), der Charlton Heston als „Omega Man“ darstellt. Er spielte wirklich überzeugend. Etwas, das er lebend nicht geschafft hätte. Und deshalb war Charlotte nicht überrascht, als sie keinen Puls fühlte. Pierre war noch warm. Das Wasser im Brunnen war leicht rötlich. Die Lanze, mit der sie ihn geopfert hatten, ganz dem christlichen Symbolismus huldigend, war aus ihm herausgerutscht und über den Rand gekullert. Es war niemand zu sehen. Wahrscheinlich hatte der Sturm in dem Augenblick aufgehört, als Pierre starb. Niemand würde unter diesen Umständen Schuld empfinden. Es war eine Tragödie.
Charlotte zog ihr Mobiltelefon aus der Tasche und rief die Polizei.

Charlton Heston, allerdings im falschen Film, als Moses in den Zehn Geboten. Aber es ist gemeinfrei und das ist doch auch was. Rot und ausgestreckte Arme hat es auch.
Zeugen
Manchmal bewegten sich Schatten hinter den Fenstern. Nach etwa 20 Minuten trafen ein Krankenwagen und die Polizei ein. Der Platz, der vorher so still war, wimmelte jetzt vor Menschen.
Ein Kommissar befragte Charlotte. Er hatte ihr einen Becher heißen Kaffee in die Hand gedrückt. Sie wäre den Becher gern losgeworden, wusste aber nicht, wohin damit. Sie hasste Kaffe ohnehin, aber dieses Zeug war wirklich untrinkbar. Charlotte überlegte, ob sie eine Ohnmacht vortäuschen solle, nur damit sie den Becher nicht mehr halten müsse. Sie wusste, dass sie unter Schock stand, aber das half nicht viel. Der Kommissar hatte einen ulkigen Spitzbart wie D’Artagnan in einem 80er Jahre Film. „Ich weiß es doch nicht!“ schrie Charlotte schließlich voller Ungeduld und Verzweiflung. „Ich wusste, dass etwas passiert ist, als der Sturm abbrach. Ich ging hierher. Da hing er, die blöde theatralische Sau.“ Dann begann sie zu weinen. Sie war aber noch geistesgegenwärtig genug, den Kaffee in die Blumenrabatte am Kriegerdenkmal zu schütten und „D’Artagnan“ den Becher in die Hand zu drücken. „Habt ihr nicht gelernt, dass Leute, die unter Schock stehen, sich besser hinsetzen?“ fragte sie dann noch. Und während bunte Flächen sich vor ihren Augen wabernd auszubreiten begannen – was natürlich niemand außer sie selbst sah – fiel sie um.
Die Gerichtsmediziner hatten den Leichnam inzwischen vom Brunnen entfernt und auf eine Bahre gelegt. Sie stürzten sich jetzt diensteifrig auf Charlotte. Maßen ihren Blutdruck. Legten ihr eine Decke um und setzten sie ein Stück die Straße hinunter auf eine Bank.
D’Artagnan entschuldigte sich. Er hieß natürlich nicht D’Artagnan. Er fand diese pummelige rothaarige Frau verdächtig. Die Stille hatte ihr verraten, dass etwas passiert war, ja klar und er war wahrscheinlich der Weihnachtsmann. Er schickte seine Kollegen los, die Anwohner zu befragen. Wie konnte das überhaupt passieren, dieses Blutbad am hellen Tag und keiner außer einer hysterischen Mittvierzigerin schien zu bemerken, dass mitten auf dem Dorfplatz eine Leiche festgepinnt war. „Die Normannen sind ein verschwiegenes Völkchen.“ sagte seine Kollegin Dubosc gerade. Als hätte sie seine Gedanken gelesen.

Tore Svennberg in Die Drei Musketiere als D’Artagnan 1903. Postkarte, unbekannter Fotograf. Lizenz: gemeinfrei
Direkt am Kriegerdenkmal wohnte ein junges Ehepaar, die Leblancs. Yves war Klempner und Simone war Taxifahrerin. Sie sagten beide gern aus. -„Ja, der hat ziemlich lange herumgeschrien. ‚Aaaah, Hilfe, nein, aaah‘ und dergleichen. Ich hab nichts verstanden und dachte, dass der Pierre nur wieder Aufmerksamkeit will. Er wollte ja immer etwas ganz Besonderes sein, die Schwuchtel.“ -„Der war keine Schwuchtel, der war bi.“ -„Ist doch das gleiche.“ -„Der hat jedenfalls auch mit Frauen rumgemacht. Ich hab gedacht, der hat da Sex am Denkmal – der war ja immer so exzentrisch, wer weiß, was so einer für Praktiken drauf hat. Hab mir jedenfalls Ohrstöpsel reingetan und mich auf die andere Seite gedreht.“ -„Nee, ich weiß nicht mit wem ers getrieben hat. Ich bin doch keine Tratschtante. Fragen Sie doch die alte Frau schräg gegenüber, die weiß alles, was im Dorf so vorgeht. Im Schloss hat er jedenfalls eine Weile gewohnt, das wird schon seine Gründe gehabt haben.“ -„Wo Rauch ist, ist auch Feuer.“ Beide nickten.
Die alte Frau von schräg gegenüber, Léontine Delestre, sagte ebenfalls gern aus. -„Ich habe immer gesagt, dass es mit dem ein schlimmes Ende nimmt. War das ein satanisches Ritual?“ Der Beamte verneinte dies. -„Wie bitte? was sagen sie?“ Der Beamte sprach lauter und formte die Worte deutlich mit den Lippen, dazu schüttelte er den Kopf, wie ein Hund nach dem Bade. -„Sie dürfen da nichts zu sagen? Ha! Wird wieder alles vertuscht! Hab ichs doch gewusst! Hab den nicht einmal in der Kirche gesehen. Komisch eigentlich, dass ich gar nichts gehört habe letzte Nacht. Hat wohl gar keinen Laut mehr von sich gegeben. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich das Denkmal mit Weihwasser besprenkele. Ich werd den Pfarrer bitten, es zu segnen. Wenn sie wissen wollen, mit wem dieses teuflische Monster Umgang hatte, dann fragen sie am besten im Nachbardorf im Bar/Tabac nach. Dort lungerte der Kerl jeden Tag herum. Traf dort auch seine Liebhaber. Der hats ja praktisch mit jedem…“ Dieses „jedem“ nahm Frau Delestre selbst natürlich aus. Über dem Kamin auf der Ablage stand ein Foto ihres verstorbenen Mannes und diverse Fotos von jüngeren Leuten und Kindern. Wohl ihre Kinder und Enkel. Frau Delestre erschreckte sich jedesmal, wenn sie Besuch bekam. Warum das so war, wusste sie nicht. Die Leute gingen alle so leise, wie die Katzen. Überhaupt hatte sich alles so verändert, es war erschreckend. Selbst der Papst war jetzt so ein Kommunist und auf den Schulhöfen bringen sich die Kinder gegenseitig um. -„Dochdoch, neulich noch in Bourges. Was sagen sie? Sie sind Protestant?“ Damit war der Beamte entlassen. Der fluchte still vor sich hin, das hätte er nicht sagen sollen, dass er Protestant ist. Da würden sie nochmal einen Katholiken hinschicken müssen.
Daheim und unterwegs
D’Artagnan verdonnerte daraufhin den jungen protestantischen Beamten dazu, Charlotte nach hause zu bringen. „Horch sie aus. Du bist jung, die Matrone hat bestimmt mütterliche Gefühle. Erzähl ihr von deinem Missgeschick bei der alten Delestre.“ Das tat der frischgebackene Inspektor Benjamin Merlin nicht gern. Er redete ohnehin nicht gern mit fremden Leuten. Aber es wurde Zeit, dass er sich daran gewöhnte. Er stellte sich der rothaarigen Verdächtigen vor und sie fuhren in seinem Auto zum Schloss, denn sie wohnte auf dem Schlossgrundstück.
An der nächsten Kreuzung lag ein toter Bussard auf der Straße. Gleich veranstaltete die Frau ein Geschrei und verlangte, dass er anhalten solle. Sie stieg aus, ging zum toten Vogel, nahm ihn an einer Klaue und trug ihn auf den grasbewachsenen Hang am Straßenrand. Sie zückte einen Fotoapparat und machte ein Foto. „Sie haben den Toten – ich meine den toten Menschen – doch nicht etwa auch fotografiert?“, fragte Inspektor Merlin. „Ja, ganz automatisch.“ Merlin konfiszierte den Fotoapparat. Sie stiegen wieder ins Auto. „So ein schöner Vogel“, sagte die Frau: „der muss aber wirklich Pech gehabt haben.“ Dann kamen sie ans Tor. Ein blaues Eisentor, das vor sich hinrostete. Charlotte wollte sich von dem Inspektor verabschieden, aber der bestand darauf, sie noch bis ins Haus zu bringen. Der Hund begrüßte die beiden überschwänglich und veranstaltete bellend ein Tänzchen. Sie gingen in ein kleines schiefergedecktes Haus.
Charlotte machte Tee und holte Kekse. Das Wohn- und Esszimmer war groß und stand voller Möbel und Nippes. Es war ein Wunder, dass nichts umfiel, obwohl der große belgische Schäferhund den Schwanz wie einen Propeller kreisen ließ. Merlin fragte Charlotte, ob sie Frau Delestre kenne und berichtete von seinem Missgeschick. Charlotte lachte. Sie sei auch als Protestantin geboren und sie ginge ab und zu auf eine katholische Messe, damit die Einheimischen sehen, dass sie nicht vom Teufel besessen ist oder dergleichen. Aber Leute wie die Delestre würden einen nie akzeptieren. Ihr Mann hatte im Kirchenchor gesungen. Dabei war er kein Chorknabe, sondern baggerte alle Frauen der Gegend an. Ja, bei ihr hatte er es auch versucht und da sei er schon so alt gewesen, dass man ihn nicht einmal mehr für seine Unverschämtheit hätte schlagen können. Hinterher bringt man ihn noch aus Versehen um. Peinliches Schweigen.

In Chören gibt es auch Frauen. Chorprobe von Anton Friedrich Thibaut. Vor 1840. Gemeinfrei.
Ob der Verstorbene ebenfalls Protestant war, fragte der Inspektor. „Ja schon, aber der war sich seiner Religion nicht sicher. Sich selbst hat er angebetet. Bei seinem Aussehen war es den Leuten auch egal, welchem Gott er huldigte.“ Merlin war nicht beleidigt. Er fand ohnehin nicht, dass er selbst gut aussah. Dann schaute Charlotte den Inspektor direkt an und erzählte.
„Ich lernte Pierre bei einer Umschulung kennen. Umschulung zum Bürokaufmann. Einer seiner Freunde bot ihm einen Job hier an, als Schlosswächter. Er nahm auch an und ich ging mit. Wir waren erst drei Monate zusammen gewesen. Er wollte nie mit mir zusammen gesehen werden, als sei ich ihm peinlich. Hinterher erfuhr ich, dass er gleich zu Beginn eine Frau in einer Nachbarstadt aufgerissen hat. Die hat ihm immer ein bisschen Geld zugesteckt. Als Schlosswächter verdient man nicht viel. Als nächstes machte Pierre sich an die Schlossbesitzer ran. Die sind schon ziemlich alt. Das machte ihm wohl nichts aus, solange genug Geld im Spiel war. War aber nicht, denn die Schlossbesitzer sind ausgesprochen geizig. Also sah er sich anderweitig um. Als das mit den Schlossbesitzern passierte, merkte ich natürlich, was los war. Das war eine schwere Zeit. Jedenfalls ging er dann und wohnte bei wohlhabenden Leuten im Nachbardorf. Die gucken mich heute noch scheel an. Keine Ahnung. Jedenfalls sagten die Leute, die hätten alle was miteinander gehabt. Das Letzte, das ich von ihm hörte, war, dass er Gesang studiere. Aber da er das selbst gesagt hat, ist das mit Vorsicht zu genießen. Er hat jedenfalls Lehrvideos zur Stimmbildung im Internet gepostet. Die hab ich nicht selbst gesehen, ein Freund, mit dem ich in einem weltlichen Chor singe, erzählte mir davon.“ „Sie hätten also ein Motiv“, ergänzte Merlin: „Verbrechen aus Leidenschaft.“ „Klar“, antwortete Charlotte: „er hat mich aber schon vor zwei Jahren verlassen, da hätte ich ihn doch schon damals umbringen müssen.“
„Was wenn sich alle zusammengetan haben, um den Typen abzumurksen?“, fragte sich Inspektor Merlin. Aber das kam ihm dann doch zu sehr nach Fiktion vor. Agatha Christie, Mord im Orient-Express. Er schüttelte den Kopf. Dann stellte er sich vor, was D’Artagnan ihn fragen würde und fragte: „Wann und woran ist Herr Delestre gestorben?“ Charlotte fragte: „Glauben Sie jetzt etwa, dass ich alle beide umgebracht habe?“ „Ich glaube gar nichts“, antwortete der Inspektor: „ich muss das fragen.“ „Das sagen sie immer“, dachte Charlotte und sagte: „Ich bin nicht gerade mit den Delestres befreundet. Ich erfuhr, dass er tot ist an dem Tag, an dem er beerdigt wurde. Ich glaube, er hatte einen Herzinfarkt. Glauben ist nicht Wissen. Warum fragen Sie nicht Frau Delestre.“ Er hatte es sich offensichtlich wieder einmal mit jemandem verdorben. -„Wie hießen die Leute, bei denen der Ermordete später gewohnt hat?“ -„Keine Ahnung. Seh ich aus wie eine Tratschtante? Auch da kann Frau Delestre Ihnen bestimmt weiterhelfen.“
Damit war Inspektor Merlin entlassen und fuhr zurück, um D’Artagnan Bericht zu erstatten. Der nahm wirklich sofort an, dass Charlotte eine Serienmörderin sei. Ihr Mobiltelefon hatten sie schon vorher konfisziert. Darauf waren keine Fotos und es stellte sich heraus, dass sie das Foto mit der Kamera wirklich nach dem Anruf an die Polizei gemacht hatte. Das Foto zeigte auch keine neuen unbekannten Details. Weitere Befragungen seitens Inspektorin Dubosc, die Katholikin war, ergaben, dass Herr Delestre auf einer Heuwiese einen Herzinfarkt gehabt hatte. Er sei erst Stunden später gefunden worden, die Sense noch in der Hand.

Der Tod und die Mädchen. 1872. Gemälde von Pierre Puvis de Chavannes. Gemeinfrei.
Die zwei Musketiere
Es war schon später Nachmittag. Der Kommissar schickte Inspektor Merlin noch in den Bar-Tabac im Nachbardorf. Dubosc wollte heim, sie hatte zwei Kinder. D’Artagnan wollte auch heim. Sein Lebensgefährte, Yves, kochte heute etwas Gutes, geschmorte Kaninchen in Weinsoße. Yves nannte D’Artagnan auch „D’Artagnan“, liebevoll. Daher können wir ihn auch weiterhin so nennen. Wenn auch vielleicht nicht liebevoll. D’Artagnan nannte Yves „Porthos“, obwohl Yves nicht dick war. Er hatte auch keinen seltsamen Bart. Sie waren halt die zwei Musketiere. Jetzt freute D’Artagnan sich auf das Kaninchen. Er durfte natürlich nicht über seine Fälle reden. Manchmal war das schwer. Er durfte aber sagen, dass ein Schloss entfernt involviert war. Schlösser, das mochten die beiden. Immerhin lebten Musketiere in Schlössern.

Er hat eine große Muskete. (Ja, tut mir auch leid von wegen dem Kalauer.) Instruktionen zur Musketenbenutzung: überprüfe die Lunte! Zeichnung von Jacob de Gheyn (II). 1607. Gemeinfrei.
Yves empfing D’Artagnan überschwänglich. Das Essen war gerade fertig geworden. Perfektes Timing. Beim Dessert erzählte der Kommissar, dass ein Louis-Treize Schloss einer der Schauplätze in seinem neuen Mordfall war. „Wie aufregend“, fand Porthos. In dem Moment fragte sich D’Artagnan, wo eigentlich die Schlossbesitzer waren. Sie waren auch einmal mit dem Opfer liiert gewesen. Vielleicht hatte die rothaarige Schlosswächterin alle, einschließlich der Schlossbesitzer umgebracht? Er merkte, dass er wirklich nicht mehr unvoreingenommen war und hielt sich vor Augen, dass dieser Mord eher die Tat eines Mannes war. Brutal, gewaltsam. Natürlich konnte es auch eine Frau gewesen sein, aber das war nicht so wahrscheinlich. Er hoffte, dass die Untersuchung der Lanze zumindest noch einiges ergeben würde. Eine nicht gerade alltägliche Mordwaffe in diesem Jahrhundert. Und so symbolisch, religiös, christlich. Er konnte sich das promiskuitive Opfer aber nicht als Jesus vorstellen. An dieser Stelle bemerkte er, dass Porthos ihn lächelnd ansah. Der war es gewöhnt, dass D’Artagnan ins Leere blickte, wenn er Eingebungen bezüglich seiner Fälle hatte. D’Artagnan nahm Porthos Hand, küsste sie und zog ihn mit sich ins Schlafzimmer.
Bar-Tabac
Inspektor Merlin war müde. Er hatte wahrlich keine Lust, mit noch mehr Leuten zu reden. Er hoffte, dass noch nicht allgemein bekannt war, dass er kein Katholik war. Immerhin war unwahrscheinlich, dass Frau Delestre an solche „gottlosen“ Orte ging. Merlin kicherte freudlos vor sich hin bei dem Gedanken, die alte Frau in einer Bar zu sehen. Er fuhr am Ortsteich vorbei, an einem verfallenen Haus aus dem 19. Jahrhundert, an der Wertstoffsammelstelle, der Grundschule und einer Autowerkstatt. „Hier tobt ja das pralle Leben“, dachte er und kicherte wieder vor sich hin. Es machte ihm selbst Sorgen, dass er so häufig kicherte. Das waren wahrscheinlich die Nerven oder die Müdigkeit. Hauptsache er würde nicht verrückt werden. Er riss sich zusammen, parkte auf dem großen Marktplatz und stieg aus. In der Mitte des Marktplatzes stand der Verkaufswagen eines Schlachtereibetriebs. Ein paar Hausfrauen standen vor der Auslage und beäugten den jungen Inspektor kritisch. Er sah harmlos aus, war aber zu schick gekleidet. Ganz in schwarz. Wahrscheinlich kam er aus Paris oder war Tourist. Und diese Haare! Merlin trug seine Haare unvorschriftsmäßig lang und war darauf sehr stolz. Er nickte den Frauen knapp zu, die daraufhin die Köpfe zusammensteckten und tuschelten. Merlin war nun das Stadt- oder eher das Dorfgespräch. Er betrat den Bar-Tabac (im Französischen ist ‚bar-tabac‘ männlich). Die Bedienung – oder sollte man Verkäuferin sagen? – war freundlich. Eine junge Frau in seinem Alter, zierlich, etwa 1 Meter 60 groß, das dunkelblonde Haar fiel in wuscheligen Locken auf die Schultern. Er stellte sich vor, zeigte ihr ein Foto von Pierre und fragte sie, ob sie diesen Mann kenne. Sie kannte Pierre, er war fast jeden Tag nachmittags von zwei bis drei aufgetaucht und habe einen Kaffee getrunken. Manchmal allein, aber meist mit ein paar Männern aus der Gegend, selten war auch eine Frau dabei. Meist bezahlte einer der Männer, Monsieur Gomez, ein Rentner in den Sechzigern, dem zwischen den beiden Dörfern ein Haus gehöre, ein ehemaliger Bauernhof, den er sehr schön ausgebaut habe. Ja, seine Frau sei manchmal dabei gewesen.
Das musste dann wohl das mysteriöse Pärchen sein, mit dem das Opfer zuletzt liiert war. Merlin ließ sich die Adresse geben und fuhr sofort hin. Den Eingang zum Grundstück der Gomez‘ versperrte eines der üblichen ländlichen Portale. Es gab eine Klingel, die aber nicht sehr vertrauenerweckend wirkte. Merlin klingelte trotzdem und wartete. Es wurde schon dunkel und ein leichter Nieselregen hatte begonnen. Der Inspektor setzte sich wieder ins Auto und hupte. Dann stieg er wieder aus, schlug den Mantelkragen hoch und versuchte durch die hohe Hecke zu spähen. War wohl niemand zu hause. Kein Licht. Er hatte die Vision, dass zwei weitere Leichen in dem Haus auf einem Teppich lagen, den sie mit ihrem Blut getränkt hatten. War nicht sehr wahrscheinlich. Nicht genug Anzeichen für „Gefahr im Verzug“ und er würde sich seinen Mantel ruinieren, wenn er übers Tor kletterte. Er versuchte, um das Grundstück herumzugehen. Irgendwo musste die Hecke doch niedriger sein, oder ausgedünnt. Auf der Westseite grenzte das Grundstück an ein kleines Wäldchen. was man in Eure so Wald nennt.. Was tut ein Bauer aus Eure, wenn er sich im Wald verlaufen hat? Er tritt zur Seite. Nein, das war nicht sehr witzig und reichte nicht einmal für ein kleines Kichern. „Eigentlich ein gutes Zeichen“, fand Merlin.

Es hat Füße! Skulptur aus einem Strandpfahl. Autoren: Kunst Uitschot Team. Gemeinfrei
Es gab ein zweites, kleineres Tor zum Grundstück. Es war unverschlossen. Der Inspektor ging eilig zum großen Fachwerkhaus. „Wenn die Gomez‘ jetzt nach hause kommen, sehe ich alt aus“, dachte er und fragte sich, ob er lieber hoffen sollte, dass das Ehepaar tot war. Er spähte durch eines der Fenster in ein gemütliches Wohnzimmer. Da in der Ecke, sah das nicht wie ein Fuß und ein Bein aus? Er eilte zur Eingangstür, sie war nicht abgeschlossen. Er öffnete die Tür und rief ins Haus: „Hallo? Ist da jemand? Ich bin Inspektor Merlin von der Brigade criminelle der Sûreté départementale.“ Das Haus antwortete mit Schweigen. Merlin sah sich schnell noch einmal um, dann trat er ins Haus. Er war sich nicht sicher, ob er lieber seine Dienstwaffe ziehen sollte, aber das kam ihm dann doch zu albern vor. Rechts war die Küche. Baguette lag auf dem Tisch in der Mitte. Die Küche roch irgendwie mediterran nach Thymian. Scharf links um die Ecke ging es ins Wohnzimmer. Ein Kamin mit einem Bratspießdrehautomaten. In der Sofaecke saß eine Marionette. Sollte das etwa ein Puppenbein gewesen sein? „Ja klar“, dachte Merlin als er um den Kamin herumging und in die Ecke schaute, in der er zuvor den Fuß gesehen hatte. Dort lag eine ungewöhnlich gekleidete Schaufensterpuppe. „Verdammt“, murmelte der Inspektor. Die Puppe war wohl umgefallen und lag im Gang zu einem anderen Zimmer. Merlin beugte sich hinunter, um sich die Puppe genauer anzusehen. Da hörte er ein Rascheln, etwas Hartes traf ihn am Kopf und er verlor das Bewusstsein.
D’Artagnan wacht auf
Als D’Artagnan erwachte, wusste er, wer Herrn Delestre umgebracht hatte. Nachts im Schlaf war er schlauer als am Tage. Er stand auf, frühstückte hastig mit Yves und fuhr ins Büro. Merlin erschien nicht zum Dienst. Er war sonst immer pünktlich. Etwas musste passiert sein. Dann ein Anruf aus dem Krankenhaus in Bernay. Frau Gomez hatte Merlin eine Statue auf den Kopf geschlagen, da sie ihn für einen Mörder hielt – zumindest behauptete sie das. Dann hatte sie seine Sachen durchsucht und seinen Dienstausweis gefunden. Sie legte ein Kissen unter Merlins Kopf und wartete. Irgendwann wachte Merlin auf und übergab sich. Er hatte furchtbare Kopfschmerzen. Da bekam es Frau Gomez, nach ihrer eigenen Aussage, mit der Angst zu tun und sie rief einen Krankenwagen. Merlin hatte eine Gehirnerschütterung. Frau Gomez war eine kräftige Frau und die Statue einer Venus mit üppigen Rundungen war recht schwer gewesen. D’Artagnan schickte Dubosc zu den Gomez und schrieb Herrn Gomez als Zeugen zur Fahndung aus. Dann rief er einen Freund an.
Manuel Delattre war ein langjähriger Freund von D’Artagnan. Delattre war 64 Jahre alt, von stämmiger Statur, hatte kurzgeschnittenes graues Haar und eine kleine Knubbelnase. Er war Schauspieler von Beruf. Er erklärte sich sofort bereit, D’Artagnan zu helfen. Er fand das alles aufregend. D’Artagnan fuhr selbst, um ihn abzuholen. „Wie sehe ich aus?“ fragte Delattre den Kommissar. „Gut, wie immer“, antwortete der ein wenig abwesend, während er sich wieder in den morgendlichen Berufsverkehr in Rouen einfädelte. „Das ist eine Kardinalfrage“, verkündete Delattre, setzte sich eine Brille auf und legte sich einen Schal um. „Ich werde sagen, dass ich erkältet und heiser bin“, fügte Delattre hinzu.
Frau Delestre machte ihnen die Tür auf. „Monseigneur Bischof!“, rief die alte Frau. Bevor sie sich von ihrer Überraschung erholen konnte, sagte D’Artagnan mit weicher Stimme, er wisse alles. Und um ihr die Gelegenheit zu geben, ihr Gewissen zu erleichtern, habe er „Monseigneur“ gebeten, ihr die Beichte abzunehmen. Sie brauche auch keine Angst haben, er würde solange im Auto warten. Mit diesen Worten trollte er sich.

Und wie seh ich aus? Illustration aus La Sorcière von Jules Michelet. Autor: Martin van Maële. Gemeinfrei.
Delattre trug den Schal locker, so dass das Kollar aus dem Fundus deutlich zu sehen war. Er flüsterte heiser, dass er sich leider erkältet habe. Frau Delestre hatte den Bischof noch nie von sehr Nahem gesehen und sie hätte die Stimme ohnehin nicht wiedererkannt. Delestre sah dem Bischof von Évreux zum Verwechseln ähnlich. Er nannte Frau Delestre: „meine Tochter“, wusste nicht, ob das zu dick aufgetragen war, beruhigte sich aber, als die alte Frau ihm mit Tränen in den Augen Kaffee und Kuchen anbot. Er nahm den Kaffee. Schließlich seufzte Frau Delestre und begann zu erzählen. „Der Kommissar hat recht, mir liegt etwas auf der Seele, obwohl mein Mann ein Schwein war, und ein Sünder und die ganze Welt besser dran ist, ohne ihn.“ Er hatte sie ihr ganzes Leben lang betrogen und die Frauen manchmal gegen deren Willen begrabscht und die Frauen dann bedroht, damit sie niemandem etwas sagen. Sie wusste natürlich Bescheid. Sie war ja nicht blöd, auch wenn er sie offensichtlich für blöd hielt.. gehalten habe. Aber dass er dann die junge Anne Fleury nach dem Kirchenchor „entfleurisieren“ wollte, wie er das nannte. Das ging einfach zu weit. Sie fuhr fort: „Ich leide unter einer Herzinsuffizienz. Ich habe immer ein bisschen von meinen Medikamenten abgezweigt, Digitoxin, und habe es ihm schließlich verabreicht. War mir egal wann es wirkt. Hatte Glück, dass er auf dem Feld umgekippt ist. Nach ein paar Tagen kann man das nicht mehr nachweisen.“ Sie lachte freudlos. Delattre gruselte es. Und er hatte ihren Kaffee getrunken! Er stand auf und eilte zur Tür hinaus. Während die verwirrte Frau Delestre ihm hinterherrief, was denn jetzt mit ihrer Absolution sei. „Lass uns schnell fahren, bitte“, flehte er. Ihm war nun wirklich kalt. Er berichtete D’Artagnan alles. Er hatte das Gespräch zusätzlich mit einem Mobiltelefon aufgenommen, das er jetzt D’Artagnan übergab.
Wenn es Nacht wird auf der Weide
Wir begeben uns jetzt wieder zum vorigen Abend zurück. Zeitreise, gar kein Problem für uns. Über dem Schloss stieg der Mond auf – ein abnehmender Halbmond um genau zu sein – und zwängte sich durch die Zweige der Bäume im Park. Die Schreie der Raubvögel über den umliegenden Feldern verebbten. Dafür rief ein Käuzchen. Es raschelte im Gras, wahrscheinlich waren es Mäuse. Hier war es sehr dunkel und sehr weitab vom Dorf. Die Schlosswächterin war das gewohnt. Sie fütterte Hunde und Katzen, sah fern, las ein Buch und ging dann schlafen. Nachts um drei rannten die Hunde laut bellend hinaus. „Nazielfen“, dachte Charlotte. Das war ein alter Witz. Eigentlich „Nazielfenzombies“. Nicht existierende Bedrohungen, die die Hunde am Abend und in der Nacht veranlassten, wild bellend hinauszurennen, um dann 5 bis 10 Minuten später wieder reinzukommen, als wäre nichts gewesen. Charlotte mochte Horrorfilme. Sie drehte sich auf die andere Seite. Das Bett war schön warm. Dann öffnete jemand die Eingangstür, und das klang nicht, als hätte der belgische Schäferhund die Tür mit seiner Schnauze aufgeschoben. Charlotte sprang auf und hörte, wie jemand den Küchenschrank öffnete, etwas herausnahm, die Walther PPK. Warum hatte sie die bloß im Küchenschrank gelagert? Die Frau wich in einen Flur zurück, dort war die Hintertür, verriegelt. Sie löste mit fliegenden Fingern die Riegel. Stieß die Tür auf. Da riss schon eine vermummte Gestalt die Tür zum Flur auf. Es konnte nur einer sein. Das war doch aber unmöglich? Nur einer hatte gewusst, wo sie die Waffe lagerte. Charlotte sah das Mündungsfeuer aufblitzen, dann traf sie ein Schlag, sie ging zu Boden, auf der Schwelle nach draußen. Ihre Welt wurde dunkel.

Albert Edelfelt (1854-1905): an der Tür. 1901, gemeinfrei
Lassie hat ein Magengeschwür
Der vermummte Mann war neben dem Tor über den Zaun gestiegen. Als er näher kam hatten die Hunde ihn gehört. Sie liefen zu ihm und begrüßten ihn freudig. Er hatte einen Plastikbeutel, aus dem er mehrere mit einem Betäubungsmittel präparierte Fleischstücke holte. Die Hunde fraßen die Fleischstücke. Am meisten bekam der große Berner Sennenhund. Der belgische Schäferhund kotzte sein Fleischstück unbemerkt wieder aus. Er hatte einen nervösen Magen. Trotzdem legte er sich kurz hin, während die anderen einschliefen. Er nutzte einfach gern jede Gelegenheit zum Schlafen. Er war uralt.
Nachdem der Vermummte auf Charlotte geschossen hatte, schnappte er sich die Schlüssel zum Tor und zum Schloss. Er kannte sich gut aus. Er lief zum Tor zurück und ließ seinen Kumpanen mit einem Lastwagen herein. Der andere Mann schimpfte und fragte, warum er geschossen habe. Womöglich würden das die Nachbarn hören. Er regte sich sehr auf. Der Vermummte erwiderte: „Sie hat mich erkannt.“ Was ihm der andere jedoch nicht glaubte. Denn er war total vermummt, nur die Augen waren zu sehen und selbst die sah man im Dunkeln nicht. Bei sich selbst dachte der Vermummte, dass es Zeit gewesen sei, so eine hässliche Person auszulöschen. Er war zufrieden. Alles lief ganz toll. Die beiden begannen das Schloss auszuräumen, sie luden antike Kerzenleuchter, Spielzeuge, Kinderbetten, Tische und Stühle in den Lastwagen.

Lassie in Florida 1965, State Archive of Florida. Gemeinfrei
Als er den Schuss hörte, wachte der belgische Schäferhund auf. „Frauchen?“ Er mochte Frauen nicht so gern, aber schließlich fütterte sie ihn immer. Er musste zugeben, dass sie auch mit der Bürste umgehen konnte und sie hatte ihm schon zweimal das Leben gerettet. Er stand also schwerfällig auf und lief zu ihr. Er stupste die sterbende Frau mit der Nase an. Die Nacht war relativ kalt. Daher blutete sie nicht so stark. Sie wachte auf und hustete Blut. Lungensteckschuss. Unschön. Wahrscheinlich würde sie ersticken, bevor sie verblutet war. Sie brachte sich in sitzende Position. „Lauf zu den Nachbarn“, sagte sie zu dem Hund und klemmte ihm ein blutiges Taschentuch hinter das Halsband. Der Hund guckte verdutzt und lief los. Charlotte machte sich wenig Hoffnung, dass der Hund wirklich zu den Nachbarn lief und dass die rechtzeitig kapieren würden, was los war. Neben ihrem Bett lag das Mobiltelefon. Sie sollte sich lieber nicht bewegen, man hatte in der normannischen Einöde nur selten Empfang und vielleicht würde sie nicht sprechen können, aber das war jetzt alles egal. Der Hund rannte. Charlotte kroch.
Die Nachbarn erwachten von infernalischem Gebelle. Vor dem Tor lärmte Charlottes belgischer Schäferhund. Hinter dem Tor lärmte ihr eigener Wachhund, ein Beauceron. Sie gingen hinaus. Am Schäferhund fanden sie das blutige Taschentuch, da riefen sie sofort die Polizei. Den Schäferhund brachten sie hinein und gaben ihm ein Leckerchen zur Belohnung. Der Hund war zufrieden. Das Leckerchen war besser verträglich als das rohe Fleisch, es war warm im Haus und es gab Männer, wenn ihm auch lieber gewesen wäre, wenn sie geraucht hätten. Er mochte den Geruch von Tabakrauch. Er legte sich hin und schlief weiter.
Charlotte war derweil sehr sehr langsam vorwärtsgekrochen. Sie fluchte innerlich vor sich hin. Das half. Sie erreichte schließlich das Telefon, das eigentlich nur ein paar Schritte entfernt gelegen hatte. Sie hatte die 15 eingespeichert und als endlich jemand abhob, konnte sie nur noch flüstern. „Schloss“, krächzte sie tonlos und ergänzte den Namen des kleinen Kaffs. Dann blubberte es in ihrer Lunge, sie hustete und spuckte etwas Blut. Gleichzeitig brach die Leitung zusammen. „Das wars also“, dachte Charlotte und machte es sich zum Sterben bequem.

Ferdinand Knab (1834–1902): Das Schlossportal. 1881. Gemeinfrei
Derweil hatten die Männer den Lastwagen beladen. Sie stiegen ein und fuhren davon. Als sie aus dem Tor fuhren, wollte der Vermummmte, der auf Charlotte geschossen hatte, das Tor wieder abschließen. Alles sollte aussehen wie immer. Aber die Nachbarn hatten sich inzwischen ins Auto gesetzt und bogen gerade um die Ecke. Also gab der Fahrer Gas und der Lastwagen sauste davon.
Die Nachbarn fanden Charlotte als Erste. Dann trudelten nacheinander die Polizei und der Krankenwagen ein. Der Krankenwagen brachte die Frau ins Krankenhaus in Bernay. Zur Notoperation.
Verklagenswert
-„Du hast doch nicht etwa R. in deinem Text verwendet?“
-„Was? Nein und ich hab schon extra drangeschrieben, dass es fiktive Personen sind.“
-„Aber du hast den Aufzug fotografiert.“
Vor dem geistigen Auge: ein Aufzug, dunkel, wahrscheinlich in einem Bürogebäude. Die Tür gleitet auf.
-„Ich kann ja einen Anwalt nehmen, dich.“ Und zu sich selbst gemurmelt: „in der ganzen verdammten Geschichte kommt nicht ein Aufzug vor.“
Vielleicht sollte ich das ändern.
Norden
Der Lastwagen fuhr nach Norden. Der Fahrer war ein bisschen nervös. Seine rechte Brust tat weh. Das hatte er manchmal. Der Verkehr in Rouen konnte außerdem wirklich übel sein. Was seine Frau jetzt wohl machte..
Sie erreichten den Hehler ohne Probleme. Lächerlich wenig Geld für das ganze Zeug. „Ich kann nicht mit zurück“, sagte der nicht mehr Vermummte plötzlich. Er schüttelte den Kopf. Dann klappte er die Sonnenblende herunter. Kein Spiegel, Mist. Dabei war sein Haar bestimmt ganz zerzaust von der Mütze. „Aber du wolltest doch bei uns bleiben“, erwiderte der Fahrer mit weinerlicher Stimme. „Und wo willst du denn hin? Du hast doch niemanden mehr.“ „Fahr nach Paris!“
Also fuhr der Fahrer – beleidigt – nach Paris. Auf dem Weg bat ihn sein Begleiter, auf einem Parkplatz anzuhalten. Kaum stand der Lastwagen, schon zückte der Mann die Walther, erleichterte den Fahrer um seinen Anteil, dann zwang er ihn auszusteigen. Die beiden gingen in ein Wäldchen. Bis zum letzten Moment wusste der Fahrer nicht – er konnte es einfach nicht glauben – was los war. Dann lag er erschossen im Farn. „War bestimmt besser für ihn“, dachte der Mörder, denn der Fahrer hatte eine seltene Art von Krebs gehabt. Jetzt gab es überhaupt nur noch einen Menschen, der wusste, wer er war. Vielleicht sollte er lieber abhauen? Nein, er würde zurückfahren und sie mundtot machen. Er ging zum Lastwagen zurück, fuhr los, an der nächsten Abfahrt ab und zurück in die Normandie. Er war hungrig. Auf dem Weg würde er in einem Fernfahrer-Restaurant etwas essen.
Natürlich gab es noch mehr Personen, die ihn kannten. So hatte er das nicht gemeint.

Paul Klee: Spärlich belaubt. 1934, gemeinfrei
Netter Besuch
Frau Gomez wirkte wirklich beunruhigt. Sie hatte ein ungutes Gefühl, da ihr Mann sich überhaupt nicht gemeldet hatte. Etwas musste passiert sein. Sie machte Kaffee für Inspektorin Dubosc, die derweil Pierres Sachen durchwühlte. Da klingelte es an der Tür. Draußen stand ein sehr bärtiger Mann, der ehemals Vermummte. Frau Gomez begrüßte ihn mit: „Was machst du denn hier? Und wo ist Gomez?“
Dubosc hatte Schnupfen. Andauernd brachten ihre Kinder Krankheiten aus der Schule mit. Wenn die Inspektorin (in der „entgenderten“ Version werde ich Inspektx schreiben) niesen musste, dann hielt sie sich den Ellbogen vors Gesicht. Sie hörte das Klingeln und rief: „Wer ist es denn?“ „Es ist nur mein Nachbar“, antwortete Frau Gomez. „Die Polizei ist da“, erklärte sie dem Bärtigen: „Sie durchsuchen alles.“ „Gomez ist verletzt“, behauptete der Bärtige. Eine Untertreibung. „Du musst mit mir kommen.“ Dabei sah er sie mit Kuhaugen an. „Ich kann jetzt nicht“, antwortete Frau Gomez: „Hol mich heute Abend ab.“ Dann küsste sie den Bärtigen innig auf den Mund.
Dubosc fand in einem Buch eine Fotografie. Das Foto fiel heraus, als sie niesen musste. Die Farben sahen ein bisschen blass aus, bräunlich. Das Foto zeigte eine blonde junge Frau in kurzem minzgrünen Rock, an die sich zwei etwa 5-jährige dunkelhaarige Jungen drängten, die quergestreifte Pullover in verschiedenen Farben trugen. Die Jungen sahen sich sehr ähnlich. Auf der Rückseite stand: Juni 1976. Das könnte ein Familienfoto sein. Vielleicht würde es ihnen helfen, Angehörige zu finden. Dubosc ging in den Flur und suchte nach Frau Gomez, sie wollte fragen, ob sie etwas über das Foto weiß. Da stand Frau Gomez vor der Eingangstür und knutschte mit dem Nachbarn. Das war aber nicht das übliche Begrüßungsküsschen. Dubosc räusperte sich. „Sie wissen schon“, fragte sie: „dass das verdächtig aussieht, wie Sie hier mit ihrem Nachbarn herumknutschen?“ Frau Gomez löste sich hastig von dem Bärtigen und wurde rot. Verteidigte sich dann, und erklärte, dass sie eine offene Beziehung führen würden, sie und ihr Mann, den sie sehr liebe. Und dass der den Nachbarn auch „abknutschen“ würde, wenn der vorbeikäme. Dabei betonte sie das Wort abknutschen extra. Es hatte sie wohl beleidigt. Sie benahm sich jedenfalls nicht sehr schuldbewusst, also zeigte die Inspektorin ihr das Foto. „Das ist Pierre mit seinem Bruder und seiner Mutter.“ -„Wissen Sie ob die Mutter noch lebt und wo sie und der Bruder leben?“ „In Straßburg glaub ich. Zumindest ist er da aufgewachsen.“ Dubosc rief sofort D’Artagnan an. Der rief daraufhin die Kollegen in Straßburg an. Sie mussten die Angehörigen ohnehin informieren, aber vielleicht wusste die Familie auch etwas, das helfen würde, den Mord aufzuklären. Der Bärtige ging unterdessen weg. Er fluchte vor sich hin, sobald er das Grundstück verlassen hatte. Er hatte keine Lust, die ganze Zeit mit dem Lieferwagen herumzufahren. Also nahm er das Auto von Frau Gomez. Die hatte mal wieder nicht abgeschlossen und der Schlüssel lag im Handschuhfach. Er fuhr in die nächste Stadt und setzte sich dort in ein Café.

Leute anno 1978. Jimmy Carter und seine Familie, U.S. National Archives and Records Administration, gemeinfrei
Die Inspektorin fand nichts besonderes mehr. Schon eine Stunde später fuhr sie zurück ins Präsidium. Kurz nach ihrer Ankunft riefen schon die Kollegen aus Straßburg an. Die Mutter sei vor drei Monaten verstorben. Dann gaben sie die Adresse des Bruders durch, der mit Frau und Kind in einer Wohnung am Stadtrand wohne. Ob jemand von den Kollegen vorbeigehen könne, fragte Dubosc, denn es sei doch nicht so schön, am Telefon vom Tod seines Bruders zu erfahren. Daher klingelte es eine Stunde später an der Tür von Familie Wagner in Straßburg (ja sowas, der Pierre hat auch einen Familiennamen). Frau Wagner öffnete die Tür und ließ den Beamten ein.
Charlotte wacht auf
Charlotte wachte auf. Alles war wie in Watte gepackt und es gab ein paar weit weg liegende Schmerzen. Sie konnte nicht sprechen. Sie war voller Schläuche überall. Sie entschied, dass dies wohl ein Albtraum sei und bemühte sich wach zu werden oder den Albtraum aufzulösen. Eine Krankenschwester kam und sagte etwas: „Hallo? Sie sind ja schon wach. Wie geht es Ihnen?“ Dann starrte sie auf irgendetwas neben dem Bett und ging wieder. „Blöde Frage!“, dachte Charlotte und fügte noch ein paar Schimpfwörter hinzu. Dann ging irgendwo eine Tür auf und Inspektor Merlin wurde in einem Rollstuhl hereingerollt. Er trug grüne Sachen, als sei er selbst ein Krankenpfleger. Ein kranker Krankenpfleger. Charlotte fand diesen Traum jetzt etwas amüsanter. „Hallo“, sagte der Inspektor und fuhr fort: „ich weiß, dass Sie nicht sprechen können.“ Dann nahm er ihre linke Hand und fragte, ob sie seine Hand drücken könne. Sie drückte. „Gut“, erklärte er: „einmal drücken heißt ja, zweimal drücken heißt nein.“ Charlotte fand das recht spannend. „Wissen Sie, wer auf Sie geschossen hat?“ fragte der Inspektor. Stimmt, da war etwas passiert, Charlotte versuchte sich zu erinnern. Das war auch wie in einem Albtraum gewesen. Und es konnte doch gar nicht sein. Aber wenn er es unbedingt wissen wollte.. Charlotte drückte einmal: „ja.“ -„Wissen Sie auch den Namen?“ „Ja.“ Dann begann der Inspektor langsam das Alphabet aufzusagen und Charlotte sollte beim ersten Buchstaben des Namens drücken. „P.“ Er schrieb es mit Kreide auf ein Täfelchen, das ihm die Krankenschwestern gegeben hatten. „I.“ „Pierre?“ fragte er verwundert. „Ja.“ „Aber der ist tot“, wandte Merlin ein. „Ja.“ Der Inspektor verabschiedete sich und rollte hinaus. Draußen wartete eine Krankenschwester, die ihn zurück in sein Zimmer fuhr. Merlin rief sofort den Kommissar an und berichtete. „Vielleicht ist sie noch nicht ganz bei sich“, vermutete D’Artagnan.

Edith Södergran im Waldsanatorium in Arosa (1911-1914), Svenska litteratursällskapet i Finland (schwedischer Literaturgesellschaft in Finnland), gemeinfrei